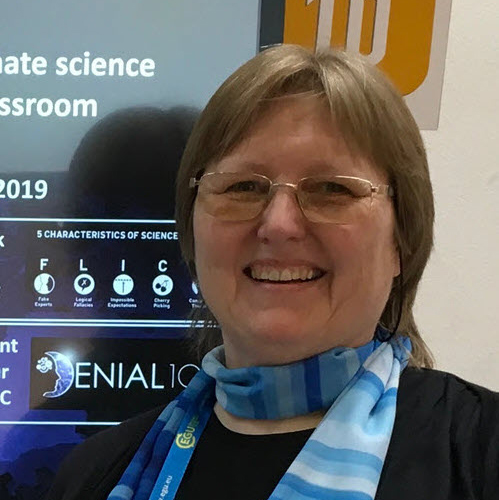Das Programm zur Fachtagung 2025
vom 9. – 11. Juli 2025
Mittwoch, 9. Juli 2025
Ort: experimenta
Ab 09:00 Uhr
Möglichkeit zur selbstständigen Besichtigung der experimenta
Ab 15:30 Uhr
Anmeldung öffnet
17:00 Uhr
Tagungseröffnung
17:30 Uhr
Keynote: Zum Schluss das Wetter
Die Vorhersage für die kommenden 100 Jahre
Frank Böttcher
Frank Böttcher nimmt uns in seinem Vortrag mit auf eine Weltreise durch das extreme Wetter unseres Planeten und liefert einen sehr gut verständlichen Überblick zum Stand der Wissenschaft. Was uns der Klimawandel wirklich alles bringen wird und wie die aktuellen politischen Entwicklungen in einem größeren Kontext zu sehen sind, kann ebenso erhellend wirken, wie seine Ausführungen zu den Prozessen in unseren Gehirnen. Am Ende werden Sie vom Wetter begeistert sein, ein paar neue Grundlagen für Zukunftsentscheidungen mehr kennen und ihr Gehirn nicht mehr unbeobachtet von sich selbst denken lassen wollen. Der mit den Outreach Award der Europäischen Meteorologischen Organisation ausgezeichnete Meteorologe ist Vorsitzender der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft und Veranstalter des ExtremWetterKongresses und der Deutschen KlimaManagementTagung.
19:00 Uhr
Gemeinsamer Ausklang mit Fingerfood und Getränken
Donnerstag, 10. Juli 2025
Ort: Forum am Bildungscampus
09:00 Uhr
Begrüßung
09:15 Uhr – 09:45 Uhr
Impuls 1: Offene Zukunft und unsicheres Wissen: Kontroverse Fragen zur Gestaltung einer guten Zukunft mit Wissenschaft und Technik
Prof. Dr. Armin Grunwald, KIT Karlsruhe
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt hat die heutige Gesellschaft mit hohen Standards an Lebensqualität, Wohlstand, Mobilität und Gesundheit möglich gemacht. Parallel sind jedoch auch problematische Folgen eingetreten wie etwa Klimawandel, Artenschwund und Mikroplastik. Daher stellen sich komplexe Fragen zur weiteren Gestaltung des Fortschritts und der Nutzung seiner Ergebnisse, so etwa zur Energiewende, zur Digitalisierung, zu Landwirtschaft und Ernährung sowie zur Raumfahrt. Da die Zukunft offen und das Zukunftswissen unsicher ist, werden diese Diskussionen von vielen Kontroversen begleitet, so etwa, auf welchem Wege, mit welchen Technologien und mit welchen politischen Maßnahmen eine nachhaltigere Entwicklung erreicht werden kann. Diese Diskussionen sollten nicht nur von Experten, sondern auch von Bürgerinnen und Bürgern geführt werden, denn die Themen gehen uns alle an.
09:45 Uhr – 10:15 Uhr
Impuls 2: Komplexität verstehen: Systemisches Denken als Bildungsauftrag
Dr. Brigitte Bollmann, PH Zürich
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist als überfachliches Ziel in den Lehrplänen der obligatorischen Schulen der Schweiz wie auch in Deutschland fest verankert. BNE ist thematisch breit angelegt und beschäftigt sich mit naturwissenschaftlichen, ökologischen, geografischen, wirtschaftlichen, gesellschaftspolitischen und/oder ethischen Fragestellungen. Interdisziplinäre Betrachtungsweisen sind für Fragestellungen einer BNE unerlässlich und erfordern den Umgang mit Komplexität.
In den letzten Jahren hat sich ein breiter Konsens gebildet, dass systemisches Denken im Sinne eines ganzheitlichen überfachlichen Zugangs eine Schlüsselkompetenz im Umgang mit Komplexität darstellt. Bestimmte systemische Konzepte haben sich in verschiedenen Fachdisziplinen bereits etabliert. Begriffe wie Ökosysteme, Wirtschaftssysteme und Gesellschaftssysteme sind weit verbreitet und stehen für systemische Betrachtungsweisen. In den obligatorischen Schulen hingegen liegt der Fokus nach wie vor stark auf dem Erwerb von fachspezifischem Wissen und analytischem Denken. Ganzheitliche Betrachtungsweisen werden nur marginal behandelt und dann meist aus einer Fachperspektive.
Dieser Vortrag geht der Frage nach, welche Grundlagen, Betrachtungsweisen oder Erfahrungen zum systemischen Denken bereits in der obligatorischen Schulzeit vermittelt werden sollten, damit künftige Generationen neben ihren analytischen Fähigkeiten auch einen ganzheitlichen Umgang mit Komplexität erlernen und auf einen überfachlichen Austausch vorbereitet sind.
10:15 Uhr
Kaffeepause
10:45 Uhr – 11:15 Uhr
Impuls 3: 1 % Inspiration and 99 % Fun: Aktuelle Forschung in den Technischen Sammlungen Dresden
Roland Schwarz, Technische Sammlungen Dresden
Mit einem Escape-Room, mehreren Sonderausstellungen im „Schaufenster der Forschung“, einem Schülerlabor und einem Bildungs-Makerspace haben die Technischen Sammlungen Dresden in den letzten Jahren begonnen, spielerische und aktivierende Science-Center-Formate zu hochkomplexen Themen aus Wissenschaften und aktueller Technologieforschung zu entwickeln. Dabei ging es bis jetzt u.a. um Quantenphysik, Klimawandel, Zellbiologie, KI und digitale Kommunikation. Die Projekte entstehen jeweils in Kooperationen mit der TU Dresden und ihren Exzellenzclustern sowie weiteren regionalen Forschungsinstituten, die sowohl finanzielle Mittel und ihre wissenschaftliche Expertise, als auch ihre Begeisterung und ihr Engagement für Forschung und Innovation und auch für Wissenschaftskommunikation in die Zusammenarbeit einbringen.
Nach einem Rückblick auf ausgewählte Projekte soll die Frage diskutiert werden, welche Erwartungen Forschungseinrichtungen und Science Center an die Kooperation richten. Welche Ziele verfolgen sie? Wie wichtig ist es für beide Seiten, einerseits Wissen und Bildung zu vermitteln, andererseits den Besuchenden ein besonderes und faszinierendes Erlebnis zu ermöglichen und nicht zuletzt dabei auch das Image der eigenen Institution und der Fachdisziplin zu verbessern? Dabei werden die Ergebnisse einer Befragung der Kooperationspartner:innen nach ihren Motiven und Erfahrungen vorgestellt. Und wie reagieren die Besuchenden? Ein Ergebnis: Edisons berühmter Satz, „Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration“ muss umgeschrieben werden.
11:15 Uhr – 11:45 Uhr
Moderierte Fragerunde zu den Impulsen
12:15 Uhr
Mittagspause
13:45 Uhr – 14:15 Uhr
Marktplatz I: Elevator pitches der Vorstellenden
14:15 Uhr – 15:30 Uhr
Marktplatz II: Explore!
15:30 Uhr
Kaffeepause
16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Marktplatz III: Debatte!
19:00 Uhr
Gemeinsames Abendessen
Ab 20:00 Uhr – 22:00 Uhr
Dessert im Foyer und Besuch der experimenta Sonderausstellung Natur.Schau.Spiele
Freitag, 11. Juli 2025
Ort: AIM am Bildungscampus
09:00 Uhr – 10:30 Uhr
Workshops 1 – 3
1. Systemisches Denken in der Praxis: Interaktive Zugänge für den Einstieg
Dr. Brigitte Bollmann
Nach dem Impulsreferat zur Bedeutung des systemischen Denkens im Umgang mit Komplexität geht es in diesem Workshop um die Frage, wie Systemdenken konkret erlernt werden kann. Dabei werden die Grundlagen systemischen Denkens sowie Möglichkeiten zur schrittweisen, altersgerechten Einführung aufgezeigt. Die Teilnehmenden lernen dazu praxiserprobte und evaluierte Methoden sowie Materialien kennen, die unter anderem an den Pädagogischen Hochschulen Zürich und St. Gallen entwickelt wurden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Unterricht der 5. bis 9. Jahrgangsstufe (alle Fächer), mit Anpassungsoptionen für ein jüngeres bzw. älteres Publikum.
Einzelne Übungen und Spielformen werden im Workshop erprobt und bezüglich der zugrundeliegenden Konzepte des systemischen Denkens reflektiert. Das Erfahrungslernen und die Verknüpfung zur Lebenswelt der Lernenden stehen dabei im Mittelpunkt.
2. Wissensvermittlung unter Druck – Umgang mit Verschwörungserzählungen und
Rechtspopulismus
Matthias Müller
In von Krisen und Ängsten geprägten Zeiten verbreiten sich vermehrt Verschwörungserzählungen und autoritäre Politikvorstellungen haben Konjunktur. Die Ablehnung demokratischer Institutionen und das Infragestellen von Wissenschaft wird vom Rechtspopulismus und Rechtsextremismus aktiv betrieben. Wie kann mit diesen Herausforderungen in Ausstellungen und Veranstaltungen souverän umgegangen werden? Wer ist erreichbar, wer vielleicht nicht mehr? Der Workshop will eine Auseinandersetzung mit den Themen anstoßen und Impulse zum Handeln geben.
3. Wissenschaftskommunikation partizipativ gestalten!?
Philipp Schrögel
Dr. Kathrin Kösters
Das heutige Verständnis von Wissenschaftskommunikation geht über das bloße Informieren der Öffentlichkeit über wissenschaftliche Ergebnisse hinaus. Wissenschaft ist eng mit der Gesellschaft verwoben und lässt sich nicht von gesellschaftlichen, politischen und ethischen Überlegungen trennen. Dies gilt insbesondere für komplexe, vielschichtige Herausforderungen wie die Klimakrise oder die Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz. Partizipative Ansätze gestalten diese Schnittstelle und ermöglichen Dialoge und die gemeinsame Schaffung von Wissen. Dabei geht es zum einen darum, eine gemeinsame Ausgangsbasis der wissenschaftlichen Hintergründe und der weiteren Themenaspekte zu schaffen. Zum anderen, dazu eine angemessene Form für den Austausch zu gestalten, welche die Komplexität des Themas abbilden kann. Der Workshop lädt die Teilnehmenden ein, darüber nachzudenken, wie eine sinnvolle Interaktion gestaltet werden kann. Gemeinsam diskutieren sie vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen: Welche Ziele können partizipative Formate verfolgen? Welche Formate gibt es für Partizipation? Welche Besonderheiten gelten für die Umsetzung in Science Centern und Museen? Wie knüpfen partizipative Formate an Forschung, die Vermittlung im Museum und andere Kommunikationsformate an, in welchen Bereichen und mit welchen Zielen können sie umgesetzt werden? Wie können wissenschaftlich und gesellschaftlich komplexe Themen am besten adressiert werden? Welche Hürden und Probleme können bei einer Umsetzung auftreten?
10:30 Uhr
Kaffeepause
11:00 Uhr – 12:30 Uhr
Workshops 4 – 6
4. Geht es auch einfacher? Ein Workshop zu Einfacher Sprache in Ausstellungen.
Julia Debelts
Texte in Ausstellungen sind oft schwer zu lesen. Sie sind zu lang, zu schwer und zu langweilig. Hier hilft Einfache Sprache: Die Texte werden verständlicher und das Lesen macht mehr Spaß. Kommen Sie in den Workshop und probieren Sie es aus …
5. Mit Klimaforschungsleugnern diskutieren ohne den Verstand zu verlieren
Bärbel Winkler
Populäre Mythen und Irreführungen wie „Die Forschung ist sich noch gar nicht sicher über die Ursache des Klimawandels“ oder „So einen heißen Sommer gab es auch schon in meiner Kindheit“ oder „Sollen doch erst einmal China und Indien etwas tun“ erschweren die Kommunikation zum Klimawandel. Dieser Workshop beleuchtet die häufigsten „Argumente“ von sogenannten Klimawandel-Skeptikern und -Leugnern und fragt, wie man sinnvoll mit ihnen umgehen sollte. Nach einem theoretischen Input und einem Quiz zu den Leugnungstechniken werden gemeinsam mit den Teilnehmenden des Workshops beispielhafte Aussagen bearbeitet, typische Argumentationsstrategien von antiwissenschaftlicher Desinformation analysiert und eigene Erfahrungen diskutiert. Dieser Workshop richtet sich an alle, die bereits mit Mythen rund um den Klimawandel konfrontiert waren und/oder für die Zukunft damit rechnen.
6. Spielerisch-kreativ mit KI tüfteln
Ryan Jenkins
Entdecken Sie spaßige und erfinderische Möglichkeiten, mit KI-Tools zu basteln, um einen Einstieg in diese aufstrebenden Technologien zu finden. In diesem praktischen Workshop werden die Teilnehmenden prädiktive und generative KI-Konzepte erforschen, indem sie einfache und gut verfügbare analoge und digitale Elemente wie Pappe, Wackelaugen, selbstgebaute Schalter, Scratch-Code und Makey Makey Boards verwenden.
Nach dem eigenen Bau von Prototypen und dem Austausch von Ideen wird es eine Diskussion darüber geben, wie diese Elemente in verschiedenen Bildungsbereichen eingesetzt werden können. Ryan Jenkins wird von seinen Erfahrungen berichten, die er im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg bei der Durchführung ähnlicher Workshops mit jungen Lernenden in Schulen, Bibliotheken und außerschulischen Einrichtungen gemacht hat. Die Teilnehmenden werden mit neuen Ideen und praktischen Tipps für den spielerischen und kreativen Umgang mit KI-Technologien nach Hause gehen.
12:35 Uhr – 12:50 Uhr
Abschlussrunde und Ende der Veranstaltung
Hilfe zum Buchungsvorgang erhalten Sie unter +49 (0) 7131 88795 – 254 oder inter.aktion@experimenta.science.